Trauung - Entscheidung
Bedeutung von Trauung
Traditionell waren das Eingehen einer ehelichen Gemeinschaft, der Eintritt in wirtschaftliche Selbstständigkeit und die Gründung eines eigenen Hausstandes in der Hochzeit aufs Engste miteinander verbunden. Die Trauung war das Ritual, das den Übergang von einem klar definierten Familienstand öffentlich bewusst machte.

Hochzeits-Dreisitz - Klosterkirche Lippoldsberg
In Laufe der letzten 40 Jahre hat sich dieses feste Gefüge aufgelöst: Der Beginn einer sexuellen Beziehung, der Start in den Beruf und das Zusammenziehen mit einer Partnerin oder einem Partner geschehen heute meist unabhängig voneinander.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Wirksame Verhütungsmittel wurden entwickelt. Junge Menschen sind länger in der Ausbildung bei früherer Abkopplung von den Herkunftsfamilien. Frauen sind dank besserer beruflicher Qualifikationen selbständiger und unabhängiger als früher.
Obwohl dauerhaften Beziehungen auch von Jugendlichen (wieder) ein hoher Wert zugemessen wird, heiraten die meisten Paare erst in einem höheren Alter. Oft gibt der Wunsch, Kinder ein verlässliches Lebensgefüge zu sichern, auch nach langen Jahren des Zusammenlebens den Impuls, sich doch noch zu trauen.
Die gesellschaftlichen Veränderungen haben Konsequenzen auch für die Gestaltung der kirchlichen Trauung. Wollte man früher stärker, gewisse Normen für das eheliche Leben vorgeben, versucht die Kirche heute, Paare bei ihrer Suche nach der ihnen angemessenen Lebensform zu begleiten und ihnen dabei einen öffentlichen Ausdruck zu verschaffen. Dazu ist es wichtig, den Eheleuten einen möglichst großen Freiraum bei der Mitgestaltung des Traugottesdienstes - insbesondere in der Formulierung des Trauversprechens - zu eröffnen.
Andererseits hat die kirchliche Trauung etwas unverwechselbar Eigenes. Wenn zwei Partner vor dem Standesamt einen Ehevertrag schließen, bekunden sie damit ihre freien Wunsch und Willen zum gemeinsames Leben. Wenn sie danach in die Kirche gehen, um Gottes Segen zu erbitten, dann bringen sie die realistische Einsicht zum Ausdruck, dass zur Erfüllung ihres Wunsches mehr als nur die eigenen Willenskräfte nötig sind.
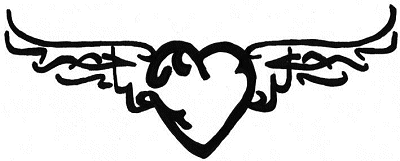
Es müssen noch andere Kräfte hinzukommen: Vertrauen, Liebe, Hoffnung auf Erneuerung - alles Dinge, die man nicht "machen" kann, die aber immer neu geschenkt werden können. Von der Lebensmacht, die wir in der Kirche "Gott" nennen.
